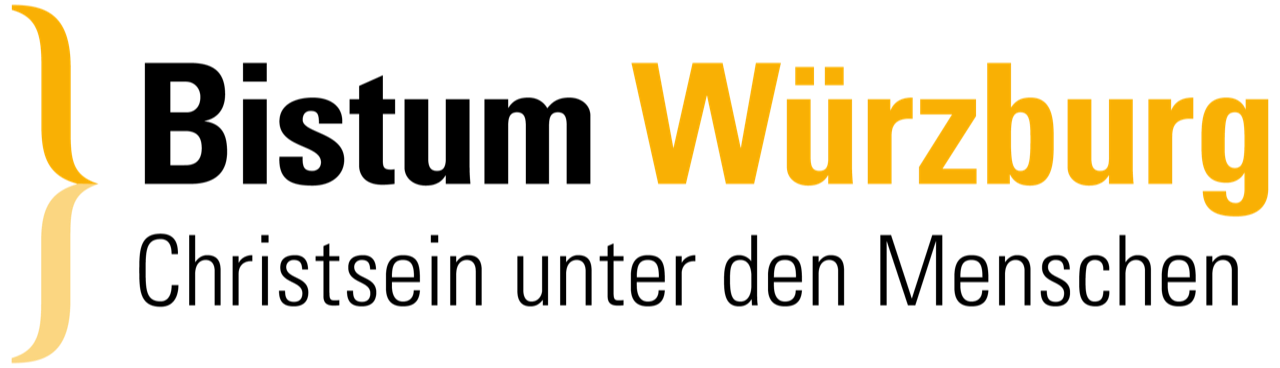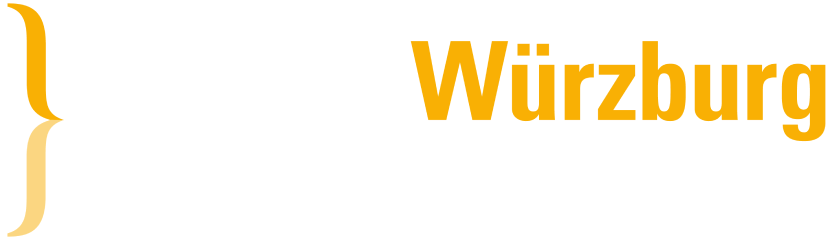Der spätgotische Bau besitzt einen eingezogenen Chor mit spätgotischen Fenstern und Netzgewölben im nachgotischen Stil. An die Nordseite des Chores schmiegt sich der Turm an, dessen urspünglicher Spitzhelm 1738 durch barocken Schweifhelm ersetzt wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert musste der Kirchner mit dem Wächter des nahegelegenen Landturms Sichtkontakt halten, um auf dessen Zeichen hin bei Gefahr die Glocke zu läuten. An der Südseite der Kirche zeugen noch heute Eisenringe vom alten Brauch, die Pferde während des Kirchweih-Gottesdienstes anzubinden; an die traditionellen Pferdesegnungen erinnern übrigens auch die beidseits des Nordportals angebrachten Holztafeln mit Hufeisen.
Bereits vor Betreten des heimelig und hell wirkenden Kirchenraums begrüßt den Besucher über dem Nordportal die erste Wolfgangsfigur, eine Arbeit des unterfränkischen Bildhauers Johann Auvera. Sie zeigt den Heiligen, dessen Gedenktag die Kirche am 31. Oktober feiert, in gewohnter Manier mit Bischofsstab und Kirchenmodell
Der barocke Hauptaltar im Inneren der Kirche stammt aus einer Würzburger Werkstatt und wurde 1699 aufgestellt. Bildbeherrschendes Motiv im Altarblatt eines unbekannten Meisters (vermutlich ein Schüler Oswald Onghers) ist der hl. Wolfgang mit zwei Kirchenmodellen – in der Hand hält der Kirchengründer ein Modell mit Spitzhelm, ein Engel hält ihm ein Modell mit barockem Schweifhelm entgegen. In der unteren Bildzone sind Menschen dargestellt, die den Heiligen um Hilfe anflehen: ein junger Mann, der sich ans Herz greift, ein Blinder mit ausgestreckten Armen, eine betende junge Frau, ein Bärtiger mit Krücken, ein Gefangener in Ketten, ein Sterbender. Im Bildhintergrund schließlich ist eine Feuersbrunst zu erkennen, die eine Stadt verschlingt und ebenfalls des Schutzes des Heiligen bedarf.
Die beiden Seitenaltäre wurden von einheimischen Künstlern gefertigt und sind der Gottesmutter Maria und dem hl. Antonius von Padua gewidmet. Das Gemälde von der Himmelfahrt Mariens auf der rechten Seite wird begleitet von Figuren der Eltern Mariens, Anna und Joachim. Die Darstellung des franziskanischen „Schlamperheiligen" Antonius wird flankiert von Figuren der heiligen Nepomuk und Aquilinus.
An der südlichen Langhauswand ist auf einer Konsole eine weitere Darstellung des hl. Wolfgang angebracht. Die spätgotische Lindenholz-Arbeit aus der Zeit um 1520 stammt vermutlich aus der Riemenschneiderwerkstatt; der obere, etwas überdimensionierte Teil des Bischofsstabes ist eine spätere Ergänzung. Das ausdrucksstarke Gesicht des Heiligen könnte laut Experten ein Altersporträt des Würzburger Bischofs Lorenz von Bibra (+ 1519) sein.
Rundgang durch ein Leben
Gewissermaßen einen „Rundgang" durch das Leben des heiligen Wolfgang bieten die zehn Gemälde an der Emporenbrüstung. Die Ölbilder von unterschiedlichen Malern aus dem 17. und 18. Jahrhundert basieren vermutlich auf Stichvorlagen aus dem 16. Jahrhundert und illustrieren gewissermaßen die gesamte Bandbreite der Wolfgangslegenden und die Verehrungsschwerpunkte. Sie zeigen von links nach rechts: (1) Die Geburt des hl. Wolfgang, (2) die Ernennung zum Domdekan von Trier, (3) die Anlainung (St. Wolfgang stemmt sich gegen einen Fels, den der Teufel auf ihn herabstürzen will), (4) der Beilwurf (zur Bestimmung des Kirchenbauplatzes), (5) die Steinerweichung, (6) Errettung eines herabstürzendes Kindes, (7) Wolfgang als Retter in Feuersnot, (8) Wolfgang als Befreier von Gefangenen (vor dem Hintergrund der Stadt Ochsenfurt), (9) Wolfgang als Retter Schwerverletzter, (10) Wolfgang als Heiler Schwerkranker und Wiedererwecker Toter.
Einen längeren Blick sollte der Besucher auch auf die Kanzel werfen, die 1551 von einem Riemenschneider-Schüler gefertigt wurde und erst 1683 in die Wolfgangskirche gelangte.
Am Schaft sind die allegorischen Darstellungen von Glaube, Hoffnung und Liebe eingemeißelt. Zu den Reliefs von St. Kilian, St. Andreas und der Kreuzigung Jesu gesellt sich neben dem Kanzelaufgang der Tod mit Sense und Sanduhr. Die den Schalldeckel bekrönende Figur des in den Wolken thronenden Gottvaters, der die Welt in Händen hält, ist eine spätere Zutat aus der Zeit um 1600.
Spätestens bei Hinausgehen fällt das kleine aber feine Blechtäfelchen neben dem Opferstock am Nordportal ins Auge. Während die eine Seite den hl. Wolfgang mit Bischofsstab und Kirchenmodell zeigt, bietet die Rückseite eine alte Ansicht der Kapelle aus der Zeit vor 1738 mit dem Mesnerhaus. Bemerkenswert: Der Verbindungsgang zwischen Mesnerhaus und Kirche, der dem Mesner einen raschen und geschützten Zugang zu Kirche (und Geläut) ermöglichte.