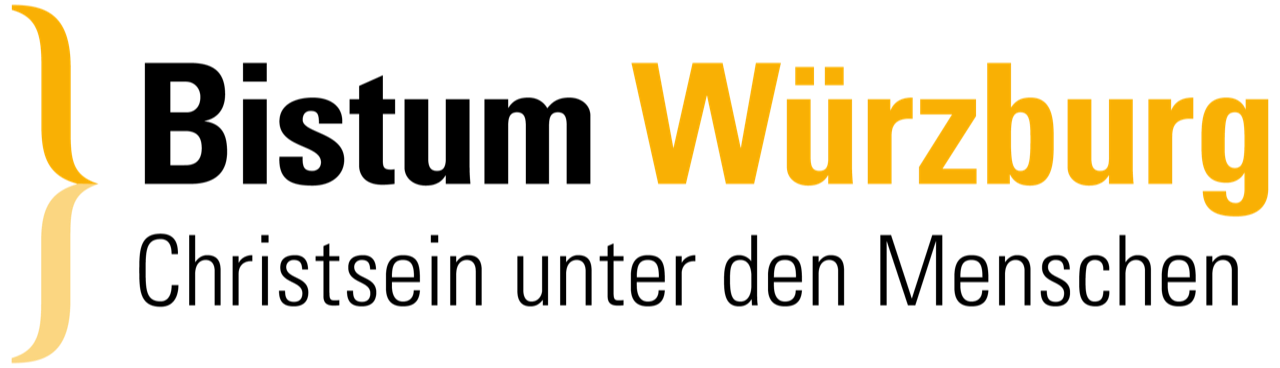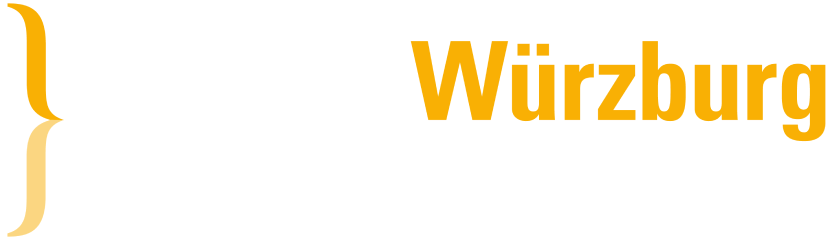„Im welligen Kahlgrund liegt zu Füßen des Hahnenkammes am Rande des Spessart der Ort Kälberau. Die Weinberge des Untermain schieben sich dicht heran. Am Ende des Dorfes erhebt sich die alte Wallfahrtskirche auf leicht ansteigendem Hügel." So beschreibt der Kirchenführer der Kirche „Maria zum rauen Wind" die Lage der Pilgerstätte. Ziel der vielen Pilger ist eine gotische Madonna mit Kind aus der Zeit um 1380. Die 50 Zentimeter hohe Figur steht seit 1957 in einer Mandorla über dem Altarblock und Tabernakel im Chorraum der alten Kirche.

Die Wallfahrtskirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Zugang aktuell nur über die Alte Wallfahrtskirche.
Hier finden Sie die aktuelle Gottesdienstordnung.
Pfarrbüro/Wallfahrtsbüro Kälberau
Trageser Weg 2 (Laurentiushaus)
63755 Alzenau-Michelbach
Telefon: 06023 / 1354 oder 06023 / 30077
Mail: pg.michelbach@bistum-wuerzburg.de
Internet: https://www.pg-apostelgarten.de
Mit dem Gesicht zu den Weinbergen
Die nach einer Legende in einem Hollerbusch aufgefundene Figur der Muttergottes wurde zunächst außen am Turm in Richtung Westen mit dem Gesicht zu den Weinbergen.aufgestellt. Eine Kapelle in Kälberau wird erstmals 1372 erwähnt. Sie hatte gottesdienstliches Recht und wurde als Filiale der Pfarrei Alzenau von den dort tätigen Benediktinern der Abtei Seligenstadt mitbetreut. 1603 wird die „Kirchenburg mit festem Ringgemäuer" erstmalig als Wallfahrtsstätte bezeichnet.
Zunächst waren es Einzelpilger und Ortswahlfahrten, die zu der damals zum Erzbistum Mainz gehörigen Kirche kamen. In Barock und Gegenreformation blühte die Wallfahrt auf, Gruppen aus dem Kahlgrund und dem Maingau bis Seligenstadt wallten zur Maria zum rauen Wind. Wallfahrtstage sind bis heute Maria Heimsuchung und Mariä Geburt, zugleich Patrozinium der Kirche.
Erst Ende des 18. Jahrhunderts in der Zeit der Aufklärung erlebte die Wallfahrt einen Rückgang. 1774 entschloss sich der damalige Pfarrer gegen den Widerspruch des Volkes, die wundertätige Madonna ins Innere des Gotteshauses zu verlegen.
Nach dem 1. und vor allem nach dem 2. Weltkrieg kamen wieder viele Gläubige nach Kälberau. Die 800-Jahr-Feier im Jahre 1934, Heimkehrerwallfahrten und das Marianische Jahr 1954 mit rund 20 Pfarreiwallfahrten und über 6000 Pilgern brachten neuen Schwung in die Wallfahrt. 1955 übernahmen die Palottiner die Wallfahrtsseelsorge, die bisherige Filiale Kälberau wurde zur Kuratie erhoben. Mit Einkehrtagen, Jugendgottesdiensten und durch die Pflege von alter und neuer Kirchenmusik hat sich der Wallfahrtsort einen Namen gemacht hat. Im Herbst 2017 haben die Pallotiner die Wallfahrtsseelsorge an das Bistum Würzburg zurückgegeben.
Heute kommen noch rund 25 bis 30 Wallfahrten im Jahr. Die größten Gruppen sind die Dekanatswallfahrt mit rund 300 Gläubigen, die Seniorenwallfahrt mit bis zu 500 Personen und die Friedenswallfahrt mit rund 100 Menschen. Aber auch Einzelpilger und Gruppen finden gern den Weg nach Kälberau, gibt es doch neben dem Gnadenbild auch eine architektonisch interessante Kirche zu bestaunen.



Wallfahrtskirche Kälberau im Bild
























Gnadenbild mit Edelstein in der Brust
Das Gnadenbild, eine gotische Madonna mit Kind, ist etwa um das Jahr 1380 entstanden. In einem Hollerbusch gefunden sollte sie an der Außenwand der Kapelle die rauen Spessartwinde abhalten. 1774 wurde das Gnadenbild von einem aufgeklärten Geistlichen ins Innere der Kirche umgezogen. Heute steht die etwa 50 Zentimeter hohe, geschnitzte Holzfigur über dem Altar im dämmrigen Chorraum der alten Kirche. Die zahlreichen Kerzen, die dort brennen, verweisen darauf, dass auch heute die Menschen noch Zuflucht, Dank und Trost bei der Maria zum rauen Wind finden.
Die Madonna weist zwei Besonderheiten auf: Zum einen handelt es sich um einen Edelstein in der Mitte der Brust. Die Legende weiß zu berichten, dass im 30jährigen Krieg ein spanischer Grenadier auf die Madonna geschossen habe. Die Kugel hinterließ in der Marienstatue ein Loch, das mit einem Edelstein geschlossen wurde. Die Kugel indes, so die Legende, prallte zurück und tötete den spanischen Frevler.
Die zweite Besonderheit ist die Taube, die auf der Hand des Jesuskindes sitzt. Der Vogel ist von Alters her ein Symbol der Seele. Auf Grabmalen werden Vögel gern verwendet, um Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Vielleicht bezieht sich die Symbolik aber auch auf eine apokryphe Schrift; eine Kindheitslegende Jesu, in der er Vögel aus Ton formte und ihnen dann Leben einhauchte und sie davon flogen. Was genau der Vögel auf der Hand Jesu beim Kälberauer Gnadenbild bedeuten, ist jedoch unklar.
Sehenswerte Doppelkirchenanlage
Die große Zahl der Pilger machte nach dem 2. Weltkrieg eine Erweiterung der Kirche notwendig. Dombaumeister Hans Schädel, der die Arbeiten in den Jahren 1954 bis 1957 durchführte, entschied sich für eine Lösung, bei der die alte gotische Kirche samt den historischen Außenanlagen weitgehend erhalten bleiben sollte. Lediglich die alte Gnadenkapelle wurde abgerissen und die beiden Kirchenbauten durch einen geräumigen Zwischenbau verbunden.
Der Neubau hat die Form eines griechischen Kreuzes. Durch helle, große Fenster wird der Blick auf Büsche und Bäume um die Kirche frei gegeben. Der Altar steht im Zentrum des Raums. Genau über dem Altar findet auch die Dachkonstruktion ihre Mitte, die mit ihren zusammenlaufenden Linien an den Himmel und die Sonne im Zentrum erinnert. Hinter dem Altar steht auf einer Säule eine Marienstatue mit Jesuskind und Taube aus dem Jahr 1450. Die alte gotische Kirche beherbergt das Gnadenbild aus dem Jahr 1380. Viele Kerzen erleuchten den in dämmrigen Licht gehaltenen Kirchenraum. Beachtenswert sind auch die beiden Heiligenfiguren St. Rochus und St Wendelin an einer Seitenwand sowie eine bäuerliche kleine Pieta, unterhalb der sich das Anliegenbuch befindet.
Der besondere Reiz der beiden Kirchenräume besteht darin, dass sich der helle, neue Kirchenraum harmonisch mit dem alten, eher dunklen Kirche zu einem Ganzen verbindet. So stellt auch der Kirchenführer nicht ohne Stolz fest: „Die Kirche in Kälberau ist eine der wenigen neuen Wallfahrtskirchen unserer Zeit, die einen hohen Rang in architektonischer Hinsicht einnimmt."
Walter Sauter
Sieben Schmerzen Mariens
Im Jahr 1710 wurde ein Stationsweg zu Ehren der Sieben Schmerzen Mariens gebaut, der in barocker Ausgestaltung entlang eines Wallfahrtsweges von Alzenau nach Kälberau führt. Die sieben Bildstöcke wurden vor rund 40 Jahren aufwändig restauriert bzw. rekonstruiert. Der zwei Kilometer lange Fahrrad- und Wanderweg ist heute Teil des Europäischen Kulturweges Alzenau 2..
Die sieben Bildstöcke zeigen unter anderem die Flucht nach Ägypten, den zwölfjährigen Jesus im Tempel, die Kreuzabnahme oder die Grablegung. Der Weg verläuft malerisch von der Burg Alzenau zunächst entlang der Kahl und Kahlgrundbahnlinie, weiter an einem Bach entlang zum Ortsrand von Kälberau und schließlich zur Wallfahrtskirche.
Quelle: wikipedia