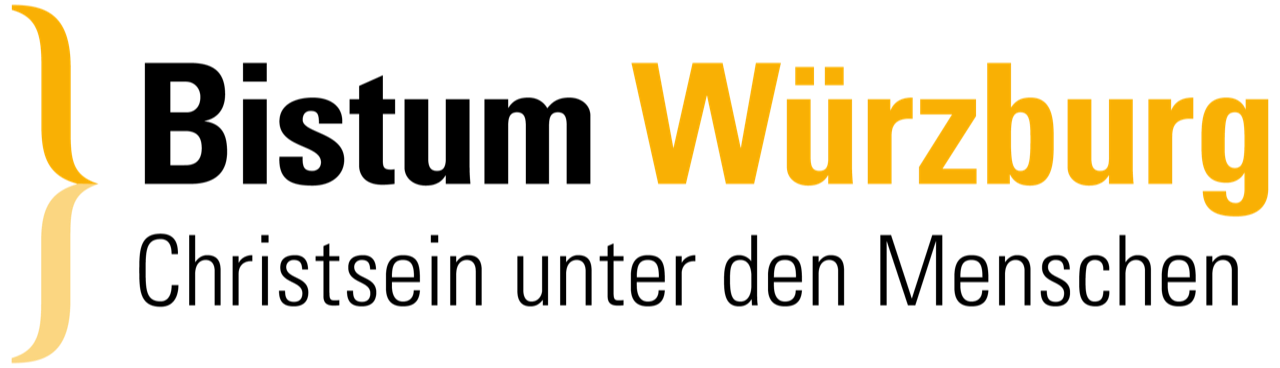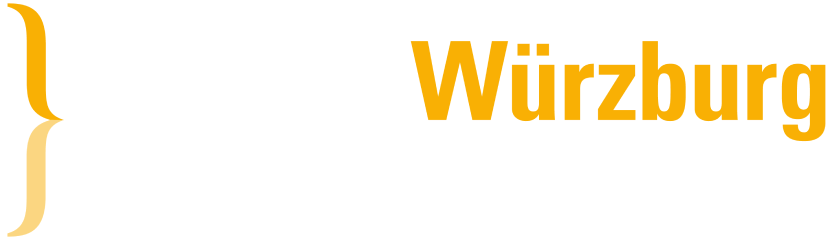Obwohl an der Höchberger Kirche die unterschiedlichsten Epochen und Stile aufeinander treffen, vermittelt sich dem Besucher ein harmonischer Gesamteindruck. Der weite und lichte Kirchenraum wird von vier spätbarocken Altären von Michel Riegel (Schreiner) und Daniel Köhler (Bildhauer) beherrscht: Die beiden Seitenaltäre (1771-73) zeigen (links) eine „Beweinung Christi" von Georg Sebastian Urlaub sowie die Anbetung der Weisen (rechts).
Im linken angedeuteten Seitenschiff steht ein Kreuzaltar im Stil des Rokoko (1773) mit dem Kreuz im Zentrum und der Mater dolorosa am Kreuzesfuß. Der Hauptaltar im Chorraum birgt das über zwei Meter hohe Gnadenbild aus der Zeit um 1470. Bis 1738 stand die Madonna am rechten Seitenaltar, während das Gemälde „Himmelfahrt Mariens" von Oswald Onghers (1658) im Hochaltar hing (jetzt an der nördlichen Chorwand).
Ebenfalls einen längeren Blick wert ist die Kanzel vom Würzburger Hofbildhauer Johann Peter Wagner. Die beiden Frauengestalten, deren es vermutlich noch eine Dritte gab, stellen wohl die theologischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung dar. An der Stirnseite flankieren zwei Putti einen Turm, der als Turm Davids gedeutet werden könnte. In der Ikonographie steht der Turm als Metapher für die Reinheit und immerwährende Jungfräulichkeit Mariens. An der Pfeilerstirnseite hängt ein Relief mit der Schlüsselübergabe an Petrus, während auf dem Schalldeckel eine Darstellung des guten Hirten angebracht ist.
Bewusst marianisch gehalten ist auch das Deckengemälde im Langhaus, wo der Besucher einen illusorischen Blick in den Himmel erhaschen kann: Eulogius Böhler inszenierte hier 1908 in barocker Manier die Himmelfahrt und Krönung Mariens. In Anlehnung an die spätbarocke Ausstattung wählte Böhler bewusst die im Barock sehr beliebte Form des Hypäthralbildes (griech. „unter freiem Himmel"). „Vom richtigen Standpunkt aus gesehen, erscheint es dem Betrachter, als würde er durch die Decke hindurch in den freien Himmel auf das Geschehen blicken. Über der Schar der Apostel, die um den leeren Sarg Mariens gruppiert sind und verblüfft hinein oder erstaunt in die Höhe schauen, entschwebt die Himmelskönigin in den Himmel. Auf Wolken kniend, wird sie von einer Schar von Engeln und Putten geleitet und in triumphaler Auffahrt nach oben getragen. Zwei Putten schweben über ihr, um ihr die Krone aufs Haupt zu setzen. Die Aufwärtsbewegung kulminiert in der Heilig-Geist-Taube, deren Lichtglanz von der göttlichen Herrlichkeit kündet, in die Maria aufgenommen wird." (Michael Koller, Kirchenführer)
Erinnerung an ein dunkles Kapitel der Geschcihte
In ein dunkles Kapitel in der fränkischen Geschichte verweist schließlich die Kreuzkapelle im Außenbereich der Höchberger Kirche, die im Zuge des Langhausneubaus an den jetzigen Standort verlegt wurde. Die Kapelle mit dem mächtigen Kreuz samt Assistenzfiguren bildet den Abschluss eines Wegs aus sieben Kreuzwegstationen, auch „Sieben Fälle" genannt. Sie ziehen sich vom Würzburger Hofbräuhaus bis in die Dorfmitte von Höchberg und wurden 1626/1627 als Sühne für die Hexenverbrennungen errichtet, deren es allein während der achtjährigen Regentschaft von Fürstbischof Ehrenberg 219 gab. Noch heute erinnert der Höchberger Ortsteil Hexenbruch an den Ort, wo die Scheiterhaufen brannten. Als Zeichen ihrer eigenen Rechtgläubigkeit soll deshalb die Bruderschaft des fürstbischöflichen Hofgesindes den Bau der Bildstöcke veranlasst haben. Neben Würzburger Bürgern steuerte übrigens auch das Domkapitel hundert Gulden bei, die Kreuzigungsgruppe wurde vom Fürstbischof höchstselbst gesponsert. An den Figuren sollen Balthasar Grohe, (Schüler Michael Kerns) Michael Kern selbst sowie der Windsheimer Meister Georg Brenck gearbeitet haben.