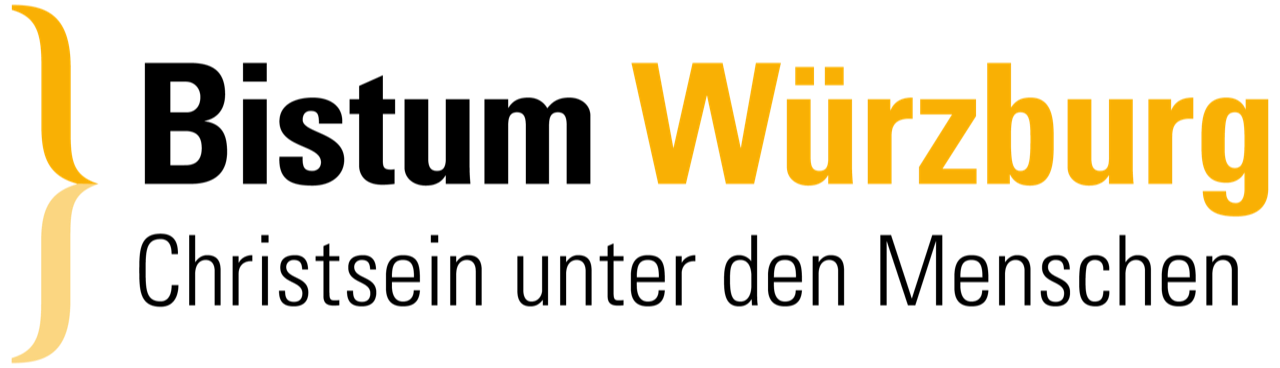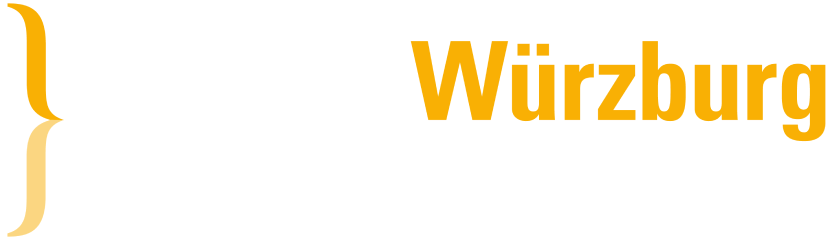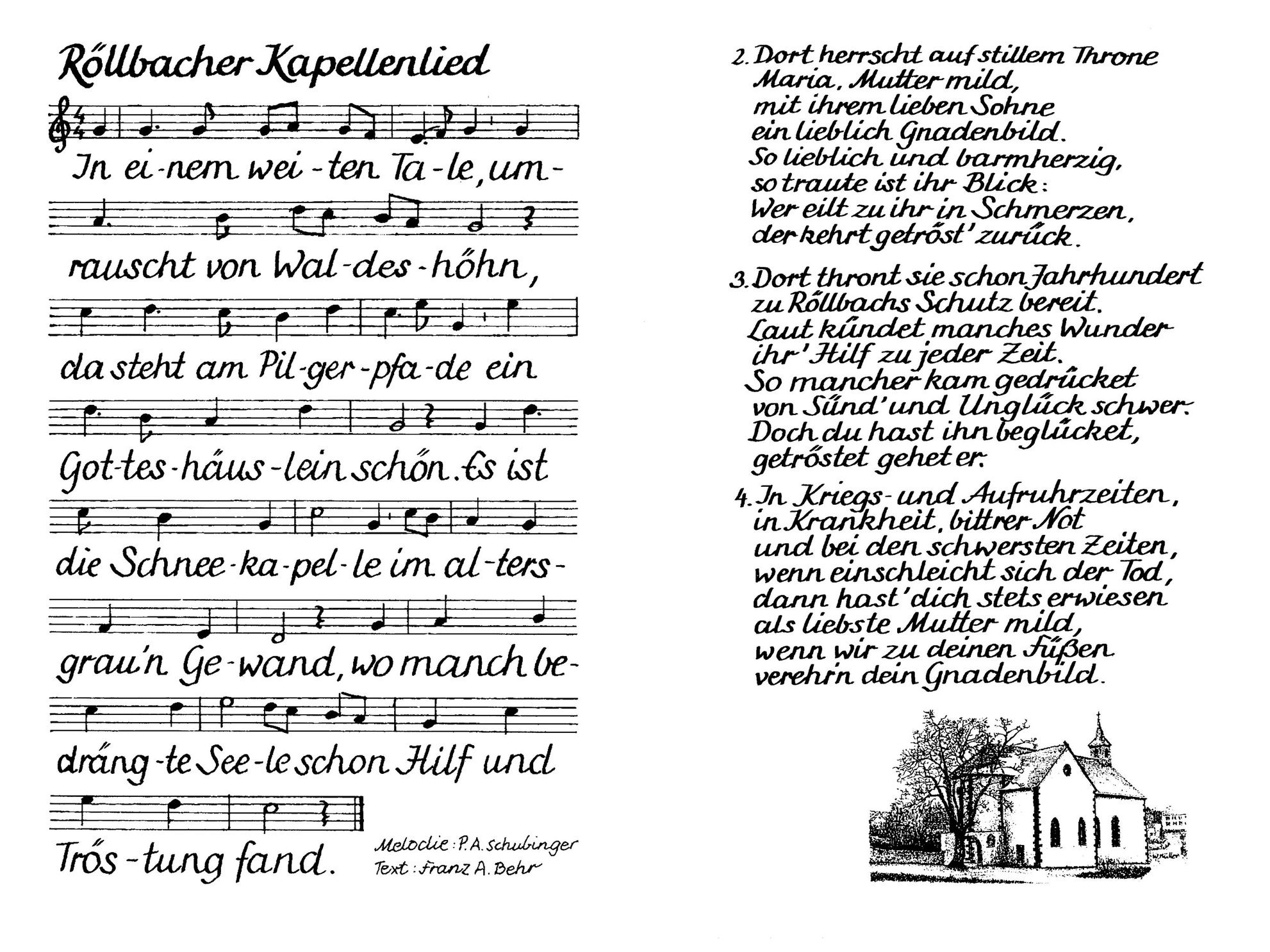Die Innenausstattung des stimmig wirkenden Raums stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Chorraum, der baulichen Keimzelle des Gotteshauses, steht der Hochaltar mit einem Gemälde der Himmelfahrt Mariens, das von einer Darstellung der Dreifaltigkeit bekrönt wird.
Der Tabernakelaufsatz mit dem reich vergoldeten Rokoko-Muschelwerk birgt das Gnadenbild, eine eindringliche aber liebevoll dreinblickende Mutter mit Kind aus dem 15. Jahrhundert. Die geringe Höhe sowie die charakteristische Form der Halbfigur sind auf den ursprünglichen Standort in einem Bildstock zurückzuführen. Eine Zeitlang wurde sogar ein alter Wurzelstock gezeigt, der das Bildnis beherbergt haben soll. Da jedoch immer wieder Holzsplitter abgeschnitzt wurden, verschloss man den Stock unter dem Hochaltar, so dass er dennoch noch immer eng mit dem Marienbild verbunden ist.
Der übrige Kirchenraum beherbergt eine Vielzahl von Heiligendarstellungen, die so einen Einblick in das Heiligenuniversum vergangener Jahrhunderte gewähren; darüber hinaus belegen die unmittelbaren Arbeiten einmal mehr, wie die Figuren über charakteristische Attribute auch von Laien eindeutig identifiziert werden konnten: So zeigt das Altarblatt des linken Seitenaltars den hl. Johannes Nepomuk, der von einer Brücke aus in den Himmel geleitet wird. Der Märtyrer des Beichtgeheimnisses, der in der Moldau ertränkt wurde, findet sich übrigens auch an einer der Langhauswände als Einzelfigur wieder. Im Altaraufsatz des linken Seitenaltars steht der hl. Antonius von Padua (mit dem Jesuskind), ein bis heute beliebter Volksheiliger. Der rechte Seitenaltar kombiniert die heilige Familie mit der Dreifaltigkeit Gottes. Über dem Altarblatt erinnert eine Figur des hl. Rochus an die einstige Bedeutung des Pestheiligen. Hinzu kommen Darstellungen der römischen heiligen Philomena (mit Anker und Pfeilen), der hl. Theresia (mit Kreuz und Rosen) und des Tierpatrons Wendelin (mit Schaf und Ziege) sowie der vier Evangelisten (mit ihren jeweiligen Attributen) an den Kanzelwänden.