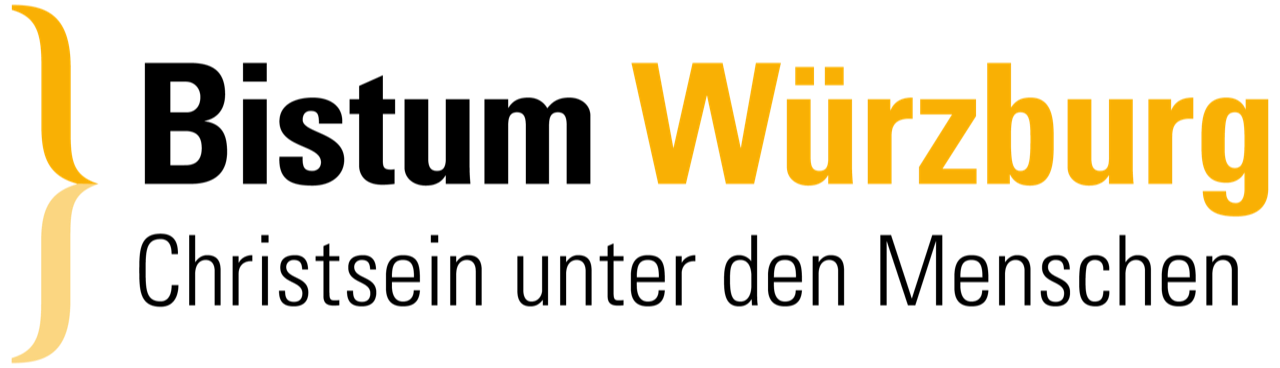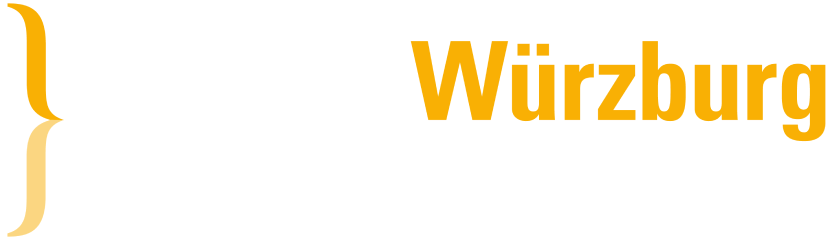Was die Faulbacher Pfarrkirche „Mariä Verkündigung" für Marienverehrer vor allem interessant macht, ist das auf den ersten Blick schlicht wirkende Marienbildnis, das auf einer Stele vor einer vergoldeten Wand steht.
Ursprünglich hatte die gefasste Holzfigur, die wohl in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden ist, ihren Platz in der nur wenige Kilometer entfernten St. Markuskapelle, die zur Kartause Grünau gehörte. Sagen ranken sich um die Entstehung der kleinen Kapelle in einem stillen Spessart-Wiesental bei Hasloch: Eine von ihnen berichtet von der wunderbaren Errettung des Wertheimer Grafen Johann mit dem Barte bei einem Jagdausflug, eine andere führt den Kapellenbau auf zwei weiße Hirsche zurück, die die Einheimischen zu einem frommen Klausner führten. Den Forschungen von Prof. Wilhelm Störmer zufolge wurde die heute ruinöse Kapelle im Jahre 1216 zu Ehren der heiligen Maria, Laurentius und Nikolaus geweiht; bereits 1297 erhielt die Kapelle eine päpstliche Ablassurkunde, die zum Grundstein für eine Marienwallfahrt wurde.
In unmittelbarer Nähe der kleinen Kapelle, die übrigens bis ins 17. Jahrhundert als Marienkapelle bezeichnet wurde, gründete die Wertheimer Erbtochter Gräfin Elisabeth von Hohenlohe 1328 das erste Kartäuserkloster in Ostfranken. Einer alten Sage nach war der Gründungsanlass ein Jagdunfall, bei dem die Gräfin ihren Gemahl versehentlich tödlich verwundete. Zur Linderung ihres Schmerzes und zur Sühne ihrer Schuld stiftete sie die Kartause in der Grünau. Die Kartäuser übernahmen auch die Markuskapelle und förderten die Marienverehrung, deren Höhepunkt wohl im 15. Jahrhundert lag. Damals entstand denn auch das Gnadenbild – eine Madonna mit Zepter und Kind im spätgotischen, mittelrheinisch weichen Stil. Das vorläufige Ende der Kartause kam abrupt: Da sich die Grafen von Wertheim der Reformation angeschlossen hatten, lösten sie das Kartäuserkloster 1557 auf. Auch die Kapelle wurde nicht mehr benutzt und verfiel zusehends. Bereits um das Jahr 1630 lag sie in Ruinen.
In dieser Zeit – zwischen 1557 und 1630 – gelangte nun die Madonna aus der alten Marien- oder Markuskapelle nach Faulbach. Vom Verlauf der Überführung erzählen zahlreiche Geschichten, in die sich auch konfessionelle Aspekte mischen. So erzählt eine Sage, dass zunächst das evangelische, zu Wertheim gehörende Dorf Hasloch die Marienfigur zu sich holen wollte, die Figur jedoch drei Mal auf wundersame Weise wieder in die Kapelle zurückgekehrt sei. Als aber die katholischen Einwohner des kurmainzischen Dorfes Faulbach das Bildnis auf ihren Karren luden, habe es ringsum geleuchtet „gleich der hellglänzenden Sonne" und wurde fortan am rechten Seitenaltar der Pfarrkirche als Helferin der Betrübten verehrt.
Ganz ungestraft blieb dieser als rechtmäßige Rettung der Gottesmutter aus Feindeshand titulierte Diebstahl indes nicht: So forderten die Mönche nach der Wiederbesiedlung der Kartause 1629 und ihrer Neuerrichtung 1635 durch die Grafen von Löwenstein-Wertheim die Figur zurück. Die Faulbacher folgten der Aufforderung jedoch auch unter Androhung von 50 Gulden Strafe nicht. Zur Untermauerung des Besitzanspruches von Faulbach entstand vermutlich die Sage von der wunderbaren Überführung.
Seitdem pilgerten die Menschen aus der Umgebung nicht mehr zur Markuskapelle, sondern nach Faulbach. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war der Zulauf sogar so groß, dass die Faulbacher Pfarrkirche zu klein wurde und man 1684 den Erzbischof von Mainz um Zuschüsse für eine Kirchenerweiterung ersuchte. Noch im 18. Jahrhundert mussten zu manchen Marienfesten geistliche Hilfskräfte aus Miltenberg kommen, um der Schar der Gläubigen gerecht zu werden. Auch das Faulbacher Wallfahrtsbüchlein von 1741 unterstreicht die Bedeutung der Madonna als wichtiges Objekt religiöser Verehrung.
Mit der Säkularisation und dem Bau einer neuen klassizistischen Kirche nach Plänen von Wolfgang Streiter 1808/09 endete die Wallfahrt; die Marienverehrung geriet zunehmend in Vergessenheit. Erst seit 1945 wird die Muttergottes, deren Figur auch weiter auf dem rechten Seitenaltar stand und der man die Verschonung des Ortes in den letzten Kriegsmonaten zuschrieb, wieder stärker verehrt. Da die Faulbacher Pfarrkirche Ende der 1950er Jahre zu klein wurde, entschied man sich 1960/1961 für einen modernen Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in den auch das Gnadenbild umzog.