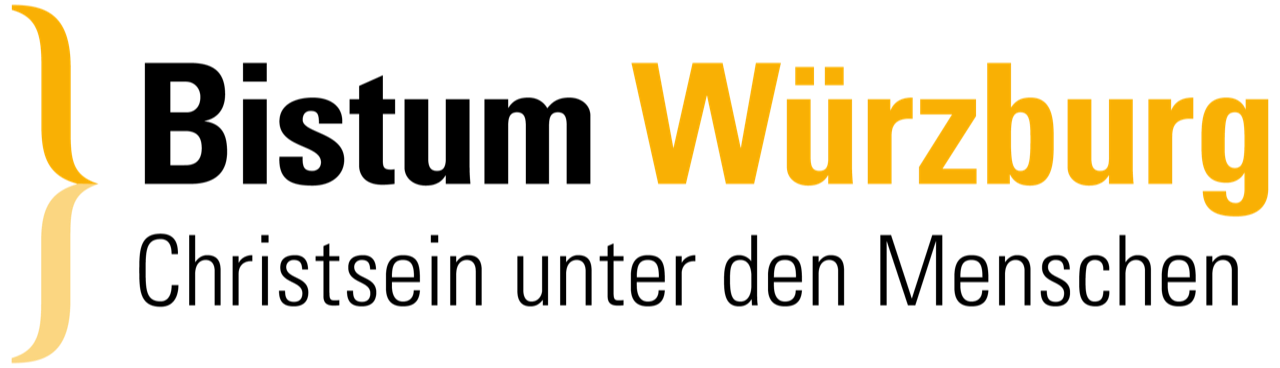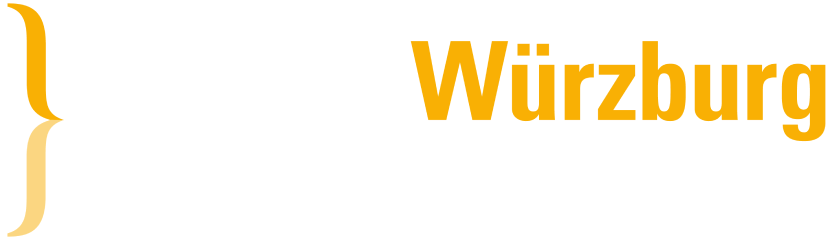Das Schönauer Gnadenbild ist – verglichen mit anderen Wallfahrtsorten – wenig traditionsreich. Und doch ist die 1704 angeschaffte Barock-Pietà für viele Gläubige wichtige Anlaufstelle und steter Helfer in der Not, denn sie zeigt „das Bild für das Leid der Menschen schlechthin". Grausame Aktualität gewann das Bildnis gerade im 20. Jahrhundert – ein Jahrhundert, das für Franziskaner-Pater Lukas Schwartz „so viele Mütter mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß gesehen hat, wie kaum ein anderes".
Obwohl die schlichte frühgotische Architektur noch an die Zisterzienserinnen erinnert, fasziniert heute vor allem die barocke Um- und Ausgestaltung des Innenraumes durch den Stukkateur Bruder Kilian Stauffer und die überbordende Ausstattung mit Bildern des Thüngersheimer Malers Georg Sebastian Urlaub zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Beherrscht wird der Kirchenraum durch die drei mächtigen Barockaltäre und die Kanzel, die Kilian Stauffer aus rötlichem Stuckmarmor und viel Gold geschaffen hat. Bei einem weiteren Rundblick durch den Kirchenraum fällt die üppige Bilderfülle in durchkomponierter Abfolge auf. Die meisten der großformatigen Gemälde stammen von Georg Sebastian Urlaub.
Das Hochaltarbild entstand 1706 – Urlaub war damals 21 Jahre jung – und hat die Unbefleckte Empfängnis Mariens zum Thema. Die in einen blauen Himmelsmantel gehüllte Maria blickt gen Himmel und zertritt dabei mit ihren Füßen den Kopf einer Schlange; umgeben ist die Darstellung von Engeln und Engelsköpfen sowie zahlreichen biblischen Bildmotiven. Bei aller strahlenden Schönheit führe die Immaculata aber vor allem den Blick hinauf zu Gottvater, Sohn und Heiligem Geist, die von oben das gesamte Geschehen betrachten und lenken. „Denn Christus ist das Zentrum unseres Lebens, auf ihn gehen wir zu", erläutert Pater Günter Thomys.
Die 13 großen Wandgemälde, die zum Teil auch von anderen Meistern stammen, stellen Szenen aus dem Leben Jesu dar, darunter die Anbetung der Hl. Drei Könige, die Darstellung Jesu im Tempel, das letzte Abendmahl, die Auferstehung sowie die Begegnungen des Auferstandenen mit Maria Magdalena.
In die „gute Stube" der Kloster- und Wallfahrtskirche, den hinter dem Hochaltar gelegenen Mönchschor, gelangt der Besucher nur im Rahmen von Führungen: Auch hier ist die Altarwand üppig in Rubens-Manier gestaltet: In einem wimmelnden Universum der Heiligen begegnen wichtige Glaubenszeugen, Kirchenväter, Ordensstifter und Heilige. Sie alle lenken den Blick hinauf zur Heiligsten Dreifaltigkeit. Außerdem findet sich hier eine in ihrer Schlichtheit bewegende Figurengruppe – Hl. Maria mit dem Kind, Johannes der Evangelist und Johannes der Täufer – aus der Riemenschneiderwerkstatt.