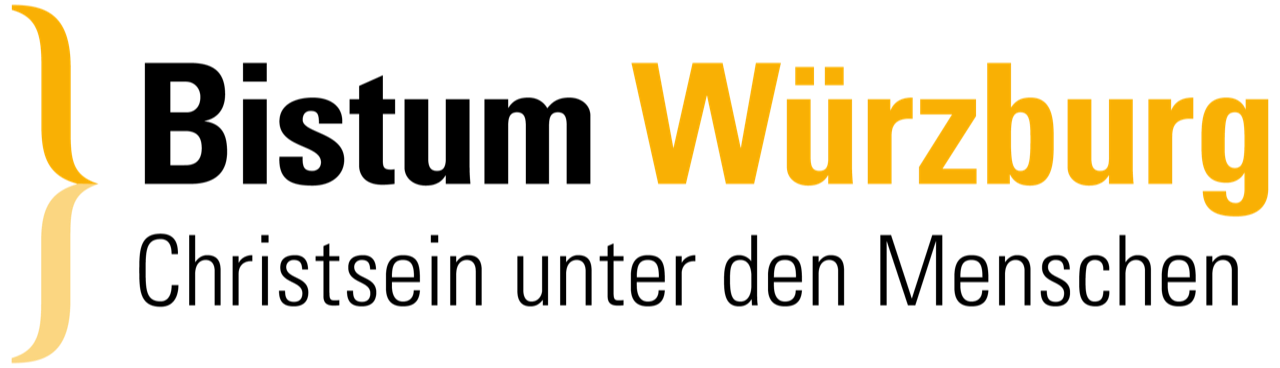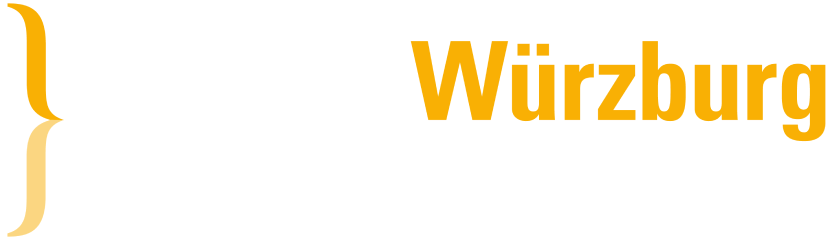Nach dem Durchschreiten des Hauptportals sollte man die Augen nach oben in den Portalbogen schweifen lassen. Dort schwebt der so genannte Viertugendmann, ein in Form eines Andreaskreuzes ausgestreckter Jüngling in gotischem Lendenschurz und mit persischer Mütze. An Händen und Füßen trägt er vier Symbole, die für die vier Kardinaltugenden Mäßigung (Schankmaß), Gerechtigkeit (Waage), Klugheit (Schlange) und Stärke (Löwe) stehen. In seiner durchkomponierten Gestaltung verkörpert er den neuen Adam, den neuen Menschen nach dem Vorbild Christi. Zugleich zeigt er über die vier Tugenden einen Weg ins Reich Gottes auf.
Der Kirchenraum wirkt nach der jüngsten Renovierung hell, lichtdurchstrahlt, harmonisch und von beeindruckender Farbigkeit. Farbgebung, Skulpturen, Freilegungen, Blumenmalereien und die Kombination neuer Ausstattungsstücke mit Vorhandenem tragen zu einer geschlossenen Raumwirkung bei. Schon im Vorraum beachtenswert sind die zarten Blumenornamente und Fresken der Evangelisten und Kirchenlehrer, das neugotische Taufbecken sowie eine barocke Ölberggruppe.
Die neu entstandene Altarinsel unter dem Chorbogen wird überragt von einem fast siebzehn Meter hohen Chorraum, in dem der Tabernakel als leuchtender Rettungsanker und Symbol der Eucharistie hervorstrahlt. Volksaltar, Leuchter, Sedilien, Vortragekreuz und Ambo wurden von Dr. Jürgen Lenssen entworfen; in den Altar sind Reliquien von Schwester Resituta, Liborius Wagner und vom ersten Würzburger Bischof Burkard eingelassen.
Hinter dem neuen Volksaltar erhebt sich eine in warmem Gold gehaltene Stele, die nun beide Haßfurter Gnadenbilder birgt: Mit Blick zu Volk und Langhaus steht die farbig gefasste Holz-Pietà aus der Zeit um 1480. Auf der Rückseite steht das ursprüngliche Gnadenbild, eine außergewöhnliche Sandstein-Pietà aus der Zeit zwischen 1390 und 1410. Diese Figur stand während der Blütezeit der Wallfahrt im 16. Jahrhundert im Zentrum des Kirchenschiffs, später rückte sie zugunsten der Holzpietà in den Hintergrund und war außen am Portal angebracht. Das Besondere an dieser Pietà ist, dass Maria ihren Sohn nicht selbst hält, sondern einen Trostengel zur Seite hat, der den Leichnam stützt und gemeinsam mit ihr den Tod Christi beweint. Die Aussage dieser Darstellung ist eindeutig: Auch in der tiefsten Not sind wir nicht alleine, sondern Gott stellt uns immer wieder einen Trostengel zur Seite, der uns spürbare Hilfe in unserem Leid ist.
Der an sich schon beeindruckende hohe Chorraum aus dem 15. Jahrhundert mit seinen aufstrebenden Fenstern, dem zierlichen Netzgewölbe und den wieder freigelegten Ornamenten strahlt die filigrane Durchlässigkeit der Gotik aus. Perfekt miteinbezogen wirken auch die Kreuzwegstationen im Stil der Nazarener. Der neugotische Hochaltar wurde 1878/1882 nach Entwürfen Heideloffs von Josef Metzger geschaffen; in den zwei Geschossen des Altares stehen zu beiden Seiten des Tabernakels die zwölf Apostel, darüber betrauert Maria den Leichnam ihres Sohnes.
Weitere beachtenswerte Ausstattungsstücke sind der spätgotische Dreikönigsaltar an der Nordwand des Kirchenschiffes aus der Zeit um 1450 mit Skulpturen von Fried Heuler sowie ein Renaisance-Relief mit einer originellen Darstellung der Auferstehung Erst kürzlich neu entdeckt wurde ein riesiges Christophorus-Fresko im Langhaus, das zumindest teilweise wieder freigelegt werden konnte.