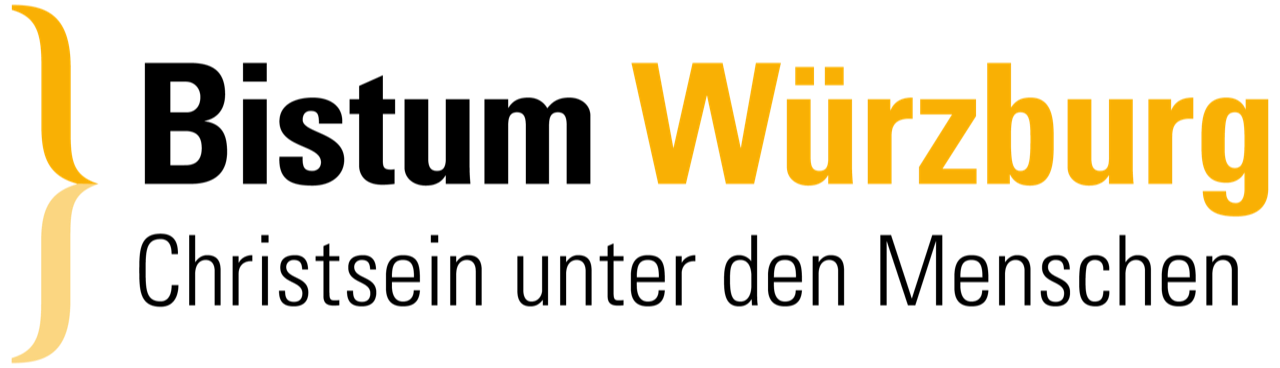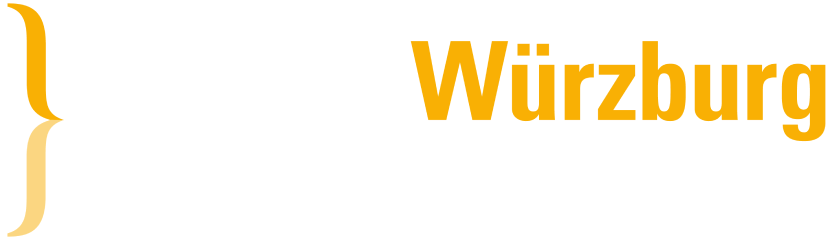„40 Tage der ihnen auferlegten Buße" wurde an bestimmten Festtagen „allen wahrlich Büßenden und Beichtenden" erlassen, heißt es weiter in der lateinischen Urkunde. Vorausgesetzt, die Pilger hören die heilige Messe oder spenden Almosen. Damit umreißt das älteste Dokument der Wallfahrt nach Hessenthal zugleich die beiden Eckpfeiler des historischen Geschehens: Glauben und Geld.
Am Beginn der Wallfahrt steht wie so oft eine wundersame Legende: Ein Ritter zweifelte an den Wundergeschichten eines Köhlers und wurde eines Besseren belehrt, als er mit den Worten: ‚So gewiss aus diesem Strauch kein Blut fließt, so gewiss gibt es keine Wunder!' auf einen Haselnussstrauch einhieb und sein Schwert blutig zurückzog. Man fand in dem Strauch eine Muttergottesfigur mit Kind. Das Bildnis wurde zuerst in einer kleinen Kapelle hoch über dem Ort, später dann in Hessenthal selbst verehrt. Der Chor der heutigen Wallfahrtskirche wurde 1439 erbaut und diente dem Geschlecht der Echter von Mespelbrunn als Grablege.
Das heutige Gnadenbild stammt aus dem Jahr 1480 und zeigt die Gottesmutter mit dem gekreuzigten Jesus im Arm. Obwohl es nicht das Original ist, sagt man auch diesem Gnadenbild Wundertätigkeit nach. Berichtet wird zum Beispiel, dass Mitte des 17. Jahrhunderts nach dem Besuch des Gnadenbilds eine taube Frau wieder hören konnte. Auch wird erzählt, dass ein schwedischer Offizier von einem tödlichen Bauchschuss gesundete und gar ein an der Pest verstorbenes Kind wieder zum Leben erweckt wurde.
Von derartigen Wundern zeugen Votivtafeln, Dankesgaben und Geldgaben der Pilgern, die mit ihren Sorgen zum Gnadenbild wallten. Laut detailliert geführter Opferverzeichnisse wurden neben beträchtlichen Geldsummen auch Hühner, Eier, Wachs oder Lämmer gespendet. Der finanzielle Segen sorgte für die Entstehung eines regelrechten Bankbetriebs. Über Jahrhunderte hinweg konnte man sich in Hessenthal zu einem Zinssatz von gerade mal fünf Prozent Geld ausleihen. Zugleich sorgte das florierende Geschäft auch immer wieder für Ärger, weil einige Kirchenbaumeister und Pfarrer offenbar am Management des Bankbetriebs scheiterten.
Im „Marianischen Gnadenfluß" des Kapuzinerpaters Renatus wird 1761 Hessenthal zu den angesehensten Wallfahrtsorten der drei geistlichen Kurfürstentümer gezählt. Nachweislich kamen die Dörfer Eichelsbach, Heimbuchenthal, Kleinwallstadt, Laufach, Roßbach, Rothenbuch, Sommerau und Waldaschaff. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen bis zu 10000 Pilger pro Jahr zur Maria zu Hessenthal; sie sorgten dafür, dass auch in Zeiten der wirtschaftlichen Umstrukturierung genügend gespendet wurde.
In diese Zeit fiel die erste „Entrümpelung" der Kirche, die nach Überzeugung vieler Hessenthaler das Ende der Wunder einläutete. Viele der unzähligen Krücken, Votivtafeln, Dankesgaben und Wunderzeichen wurden 1860 kurzerhand verbrannt. Heute sind nur noch wenige Medaillen und Kreuze erhalten, die bei den Prozessionen mitgetragen werden.